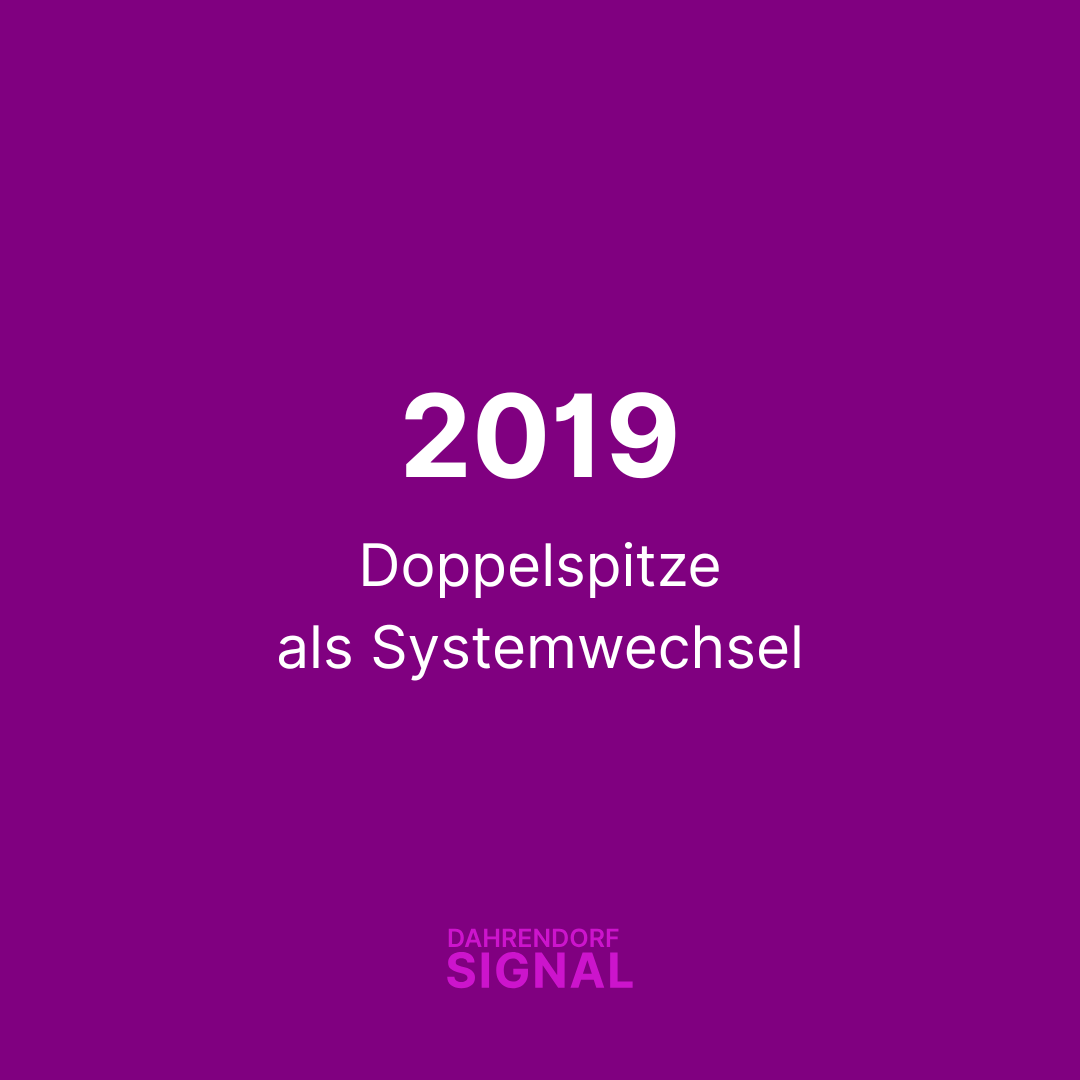2019 - Doppelspitze als Systemwechsel
Partei-Statuten im Umbau. Dazu Nahverkehr, KulturInklusiv und Gewerbemietpreisbremse.
Die SPD Berlin zieht den Schraubenschlüssel fester: Doppelspitzen vom Kiez bis zur Landespartei, mehr Mitgliederbeteiligung, klare Kante im Ordnungsrecht der eigenen Organisation. Und draußen in der Stadt konkrete Hebel für Mobilität, Kulturteilhabe und Gewerbe.
Mein Name ist Andreas Dahrendorf, 58, SPD-Mitglied in Berlin-Kreuzberg-61. Wenn man 2019 im Corpus blättert, wirkt die Partei weniger wie eine Rednerbühne, mehr wie eine Werkstatt: Satzungen werden umgeschrieben, Verfahren nachgezogen, Zuständigkeiten gestrafft. Das klingt trocken, ist aber politisch handfest. Denn parallel dazu versucht die SPD, Berlin in den Alltagsdetails freundlicher zu machen: günstiger in Bus und Bahn, verständlicher an Knotenpunkten, inklusiver in Theatern und Clubs, berechenbarer für kleine Läden. Und immer wieder leuchten dieselben Marker auf: „Doppelspitze“, „Mitgliederbefragung“, „Leuchtturmprojekt“, „Gewerbemietpreisbremse“. Das ist keine Pose, das ist Mechanik.
Parteiorganisation: Die Doppelspitze wird zur Regel und die Basis rückt näher
Die wichtigste Bewegung spielt sich im Maschinenraum ab. Zuerst auf Kreisebene: Die SPD erlaubt den Untergliederungen, statt einer Person künftig paritätische Doppelspitzen zu wählen. Eine Konstruktion, die ausdrücklich eine Frau einschließt. Wörtlich heißt es: „Anstelle einer oder eines Vorsitzenden … kann eine auf das Geschlecht bezogene paritätisch besetzte Doppelspitze, davon eine Frau, gewählt werden.“ (Antrag 06/II/2019). Das liest sich wie ein juristischer Ziegelstein und ist gerade deshalb stabil. Es verankert Gleichstellung nicht in Appellen, sondern in Wahlordnungen.
Die Öffnung zieht nach oben weiter. Vor künftigen Vorstandswahlen der Landespartei soll es, sobald mehr als eine Kandidatur vorliegt, eine Mitgliederbefragung geben. Und auch hier wird die Doppelspitze als Option festgeschrieben. Die Satzung bekommt dafür einen frischen Absatz; die Formulierung ist identisch präzise: „… eine paritätisch besetzte Doppelspitze, davon eine Frau, …“ (Antrag 07/II/2019). Genau diese trockene Klarheit entzieht dem ewigen „Ob“ die Debatte und verschiebt sie ins „Wie“.
Wer suchte, fand 2019 kaum noch Winkel, in denen die Praxis ungeregelt blieb. § 23b (2) Nr. 1 des Organisationsstatuts wird so geändert, dass sogar auf Abteilungsebene eine Doppelspitze als gleichberechtigte Führung vorgesehen ist, sobald der Bundesparteitag die Rahmenbestimmung schafft. Damit steht die Architektur von oben bis unten (Antrag 03/II/2019).
Zugleich werden Gremienrechte sortiert: Wer mit beratender Stimme an Landesparteitagen sitzt, vom Landesvorstand über Senatsmitglieder bis zu den Bezirksämtern, ist in § 15 (2) jetzt explizit gelistet (Antrag 07/I/2019). Transparenz statt Tradition: Die Partei schreibt ihre gelebte Praxis in Normtext, damit niemand mehr mit Bauchgefühlen verhandelt.
Am Rande, aber mit Wirkung: Ein Antrag zur bundesweiten Entsprechung erklärt, wer auf Bundesparteitagen mitredet, ebenfalls im Geist von 2018 („SPD organisatorisch erneuern“). Für Berlin ist das weniger Paukenschlag als Referenzrahmen, aber es fügt sich ins Bild der geregelten Offenheit (Dokumentationsstrang 2019, mit Verweisen auf 01/II/2018).
Kurz gesagt: 2019 macht die SPD Berlin aus der „Doppelspitze“ keinen Leitsatz, sondern ein Betriebssystem und verbindet es mit einer Mitgliederbefragung, die Legitimität verbreitert und Konflikte abfedern kann. Das ist die technische Seite von „mehr Demokratie wagen“.
Mobilität: Verkehrswende im Kleingedruckten, sichtbar, wenn man an der Haltestelle steht
„Mobilitätswende“ ist ein großes Wort. Die SPD Berlin übersetzt es 2019 in kleine, sichtbare Dienste. Leuchtturmprojekt 26 will an zentralen Orten digitale Monitore aufstellen, die Abfahrtszeiten, Verspätungen, Fußwege, Sharing-Optionen, Mitfahrgelegenheiten und Taxiwarten anzeigen. Dazu Echtzeit-Hinweise zur Verkehrslage, um Staus vorzubeugen. Das ist nicht glamourös, aber genau die Art Service, die Städte begreifbar macht: Der Knotenpunkt erklärt sich selbst.
Die Preisschraube dreht Leuchtturmprojekt 27: Der Weg zum 365-Euro-Ticket wird offen beschrieben. Schon jetzt, so argumentiert die SPD, bringt das Firmenticket das Jahresabo in Reichweite von 452 Euro. Der Rest ist politischer Wille, Haushaltsfrage und Verhandlungskunst. Ziel bleibt klar: „attraktiver machen“ für Umsteiger*innen aus dem Auto. Berlin als Wien-Variante, nur mit größeren Rädern.
Wo der Bund bremst und der Tarifdschungel zäh ist, legt die Partei Dateien statt Plakate vor. Das hat einen Charme: Mobilität wird administrativ statt ideologisch. Man spürt die Absicht, Barrieren im Alltag zu senken, nicht den moralischen Zeigefinger zu heben.
Ein eigener Strang: das Azubi-Ticket. Der Beschlusskurs fixiert, dass Anspruchsberechtigte es für 365 Euro pro Jahr bekommen sollen. Ein klares, finanzierbares Versprechen mit sozialem Einschlag (Beschlusslinie im 2019-Korpus). Für eine Hauptstadt, deren Berufsbildung immer noch den Busfahrplan spürt, ist das mehr als eine Nettigkeit. Es ist Startchancengerechtigkeit im Monatsabo.
Kultur & Inklusion: „Modellstadt KulturInklusiv“. Rampen, Honorare, Haltung
Wer „Teilhabe“ sagt, muss Rampen bauen. Leuchtturmprojekt 28 erklärt Berlin zur Modellstadt für KulturInklusiv. Das klingt nach Etikett, ist in den Details aber Verwaltungsarbeit: Servicestelle, Vernetzungsplattform, barrierefreie Häuser, Förderlinien für inklusive Projekte. Und der kulturelle Reflex, Menschen mit Behinderungen nicht nur als Publikum, sondern als Kunstschaffende mitzudenken. Das ist der seltene Fall, in dem die SPD aus dem Wort „inklusive Gesellschaft“ handfeste Infrastruktur macht.
Warum das zählt? Weil Kulturpolitik in Berlin oft zwischen Großsubvention und Feuilleton verloren geht. Die SPD setzt 2019 den Alltagsschraubendreher an. Zugänge, Hinweise, technische Standards. Barrierefreiheit ist hier kein Projekt, sondern Gebrauchsanweisung für Häuser und Ämter.
Wirtschaft & Gewerbe: Zukunftsorte kartieren und kleine Läden schützen
Berlin wächst, aber nicht jeder Kiez verdient an der Geschichte. 2019 versucht die SPD, das Innovations-Berlin und das Gewerbe-Berlin zusammenzubinden. Die Partei will die Zukunftsorte, die forschungsnahen Cluster, digital erfassen, Kooperationsnetzwerke stärken und eine Start-up-Map aufsetzen. Das ist die datenpolitische Seite: Wer weiß, was wo ist, kann Talente und Flächen zusammenbringen.
Die andere Seite ist der Schutzraum. Deshalb drängt die SPD über eine Bundesratsinitiative auf eine Gewerbemietpreisbremse. Für viele Kieze ist das keine Ideologie, sondern Überlebensfrage: Wenn die Miete schneller steigt als der Umsatz, verschwindet zuerst die Nachbarschaftsökonomie, dann die Vielfalt. 2019 verschiebt die SPD die Debatte von der Romantik („Kiezläden retten“) in den Paragrafen („Preisbildung regulieren“).
Was hier auffällt: Die Partei denkt regional. Sie nennt ausdrücklich die Kooperation mit Brandenburg bei der Erschließung neuer Zukunftsorte. Das ist Realismus, die Stadtgrenze ist für Pendel-, Flächen- und Energiefragen längst porös.
Bildung & demokratische Kultur: Von der Schule bis in die Partei
2019 ist kein großes Bildungsjahr und doch steckt in den Papieren der didaktische Faden. Politische Bildung taucht als Selbstanspruch auf: Wenn die Partei ihre eigenen Verfahren öffnet (Mitgliederbefragung, Doppelspitzen), wirkt das demokratiepädagogisch bis an die Basis. § 15 sortiert, wer mitreden darf und damit auch, wer lernt, zuzuhören (Antrag 07/I/2019). Die Grenzlinie ist kalkuliert: Offenheit ja, verbindliche Zuständigkeit ebenso.
Man kann das kleinreden. Oder man liest es wie die Stadt: als Fähigkeit, Konflikte zu strukturieren, statt sie nur zu moderieren. In Zeiten, in denen jeder zweite Tweet „Referendum!“ ruft, ist ein kluges Verfahren die erwachsene Antwort.
Sicherheit, Antifaschismus, soziale Kohäsion: Der Ton bleibt administrativ
Der 2019-Korpus ist nicht das Jahr großer Antifa-Leitsätze, vieles davon wurde in anderen Jahren schärfer gesetzt. Aber der Ton ist erkennbar: Rechte sind kein Ordnungsproblem, sondern ein Demokratieproblem, und dem begegnet man mit Institutionen, nicht mit Gefühlen. Dass die Partei parallel Parteiordnungsverfahren schärft (Stichwort: diskriminierendes Verhalten), passt ins Bild: Schutz nach innen ist Voraussetzung für Haltung nach außen (Antrag 10/I/2019 – in der Dokumentation als § 35-Schärfung geführt).
Bemerkenswert ist, was nicht passiert: Keine großen Selbstinszenierungen, keine Sprungideen. 2019 wirkt wie eine Grundierung, damit die Farbe später hält.
Verwaltung & Digitales: Service-Stadt ohne Fanfare
Die SPD spricht 2019 über Service statt über Revolution. Die Mobilitätsmonitore (Leuchtturm 26) sind genau das: Verwaltungs-UX. Informationen dorthin bringen, wo die Entscheidung fällt. Am Platz, in Echtzeit, ohne App-Zwang. Das ist Digitalpolitik ohne Hype. Es wird nicht das Betriebssystem der Verwaltung umgebaut, aber die Erfahrung der Bürger*innen, ganz im Sinne einer Service-Stadt.
Im Untergrund der Papiere liegt der Gedanke: „Modernisieren“ heißt nicht immer „neu bauen“. Manchmal heißt es: anzeigen, verknüpfen, vereinfachen. Die SPD macht 2019 in vielen Sätzen genau das und widersteht der Versuchung, alles als „Innovation“ zu etikettieren.
Konfliktlinien: Mehr Demokratie vs. klare Zuständigkeit, und das ewige Geld
Wer die Anträge als Protokoll liest, erkennt drei Bruchlinien:
(a) Basisdemokratie vs. Führungsverantwortung.
Doppelspitzen verbreitern Legitimität, aber sie verdoppeln nicht automatisch die Entscheidungskraft. Das setzen die Texte implizit voraus, wenn sie die Modelle optional machen und vor jeder Wahlperiode über das gewünschte Vorstandsmodell abstimmen lassen (Antrag 08/II/2019). So wird aus dem Prinzip eine prozessuale Entscheidung, eine, die Reibungen reduziert und Zuständigkeiten klärt.
(b) Anspruch vs. Haushaltsrealität.
Ob 365 Euro im Jahr oder kostenreduzierte Firmenabos, der Wille ist klar, die Rechnung folgt. Die SPD signalisiert Finanzierungspfade, ohne sie auszubuchstabieren; das ist in einer Koalition normal, aber es bleibt der Test im Haushalt (Leuchtturm 27).
(c) Wettbewerbsfähigkeit vs. Kiezschutz.
Die Start-up-Map will Sichtbarkeit, die Gewerbemietpreisbremse will Schutz. Die Balance ist fragil: Berlin soll innovativ sein, aber nicht die Bäckerei verdrängen. Der 2019-Korpus wählt dafür den Weg über Bundesratsinitiativen und digitale Erfassung. Also wieder: Werkzeuge statt Werbeslogans.
Sprachliche Marker 2019: „Doppelspitze“, „Mitgliederbefragung“, „Leuchtturmprojekt“, „sozial-verträglich“
Es fällt schwer, 2019 ein großes Wort zu geben, weil die kleinen Worte alles tragen. „Doppelspitze“ steht für einen strukturellen Kulturwandel, nicht als Kampfbegriff, sondern als Voreinstellung. „Mitgliederbefragung“ macht aus internen Wahlen öffentliche Verfahren. „Leuchtturmprojekt“ erdet die große Idee in abzählbaren Maßnahmen. Und „sozial-verträglich“ ist der rote Faden, wenn Preise gesenkt oder Dienste erweitert werden. Das ist die Grammatik eines Jahres, das Governance übt.
Was 2019 nicht ist und warum das wichtig ist
2019 ist keine große mieten- oder drogenpolitische Kehrtwende im Landesverband (die Wellen schlugen 2018 und 2020 an anderer Stelle höher). Es ist kein Jahr der Selbstinszenierung. Und es ist kein Jahr, in dem die SPD Berlin versucht, mit einem einzigen Beschluss die Stadt umzudrehen. Stattdessen ist es die präzise Justierung vieler kleiner Stellschrauben, die am Ende darüber entscheiden, ob die Partei entscheidungs- und anschlussfähig bleibt.
Die berühmte Frage, ob Politik „liefern“ kann, wird hier nicht mit Versprechen beantwortet, sondern mit Paragrafen, Prozessen und Preispfaden. Das ist weniger glamourös, aber es erhöht die Trefferquote in der Realität.
Fazit 2019
Die SPD Berlin macht 2019 das, was man in Unternehmen „operatives Exzellenzprogramm“ nennen würde: Strukturen normieren, Beteiligung klarziehen, Verfahren härten, und draußen in der Stadt Erleichterungen liefern, die man spürt, ohne darüber zu debattieren. Die Doppelspitze ist jetzt System, die Mitgliederbefragung kein Goodwill mehr, sondern Regel, die Gremien sind sauber definiert (Anträge 06/II/2019, 07/II/2019, 03/II/2019, 07/I/2019). Im Alltag setzt die SPD auf sichtbare, kleine Fortschritte: Monitore am Platz statt App-Predigten, Tarifpfade statt Tarifträume, Rampen statt Rhetorik, Gewerbemietbremse statt Kiezkitsch (Leuchttürme 26–28; Gewerbestrang). Das ist die Handschrift eines Jahres, das die Stadt bedienbarer machen will und die Partei entscheidungsfähiger.
Nächstes Mal: 2020 – Mieten-Deckel, Pandemie-Schock, Belastungsprobe für Verfahren und Versprechen.
dahrendorfSignal, not noise