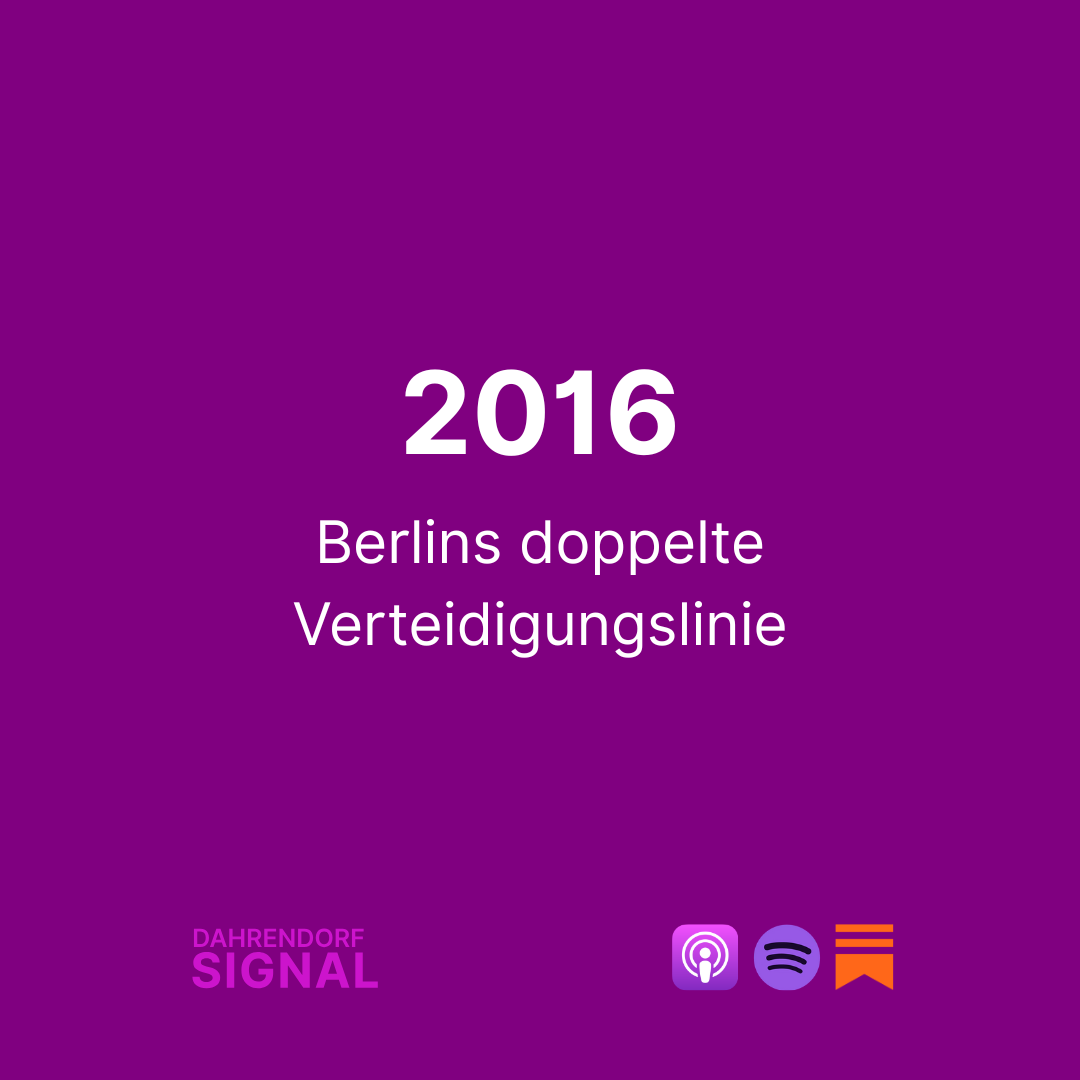2016: Berlins doppelte Verteidigungslinie
Das Jahr 2016 war kein gewöhnliches Wahljahr für Berlin.
Die SPD selbst bezeichnete es als ein Jahr, in dem es galt, "Rassisten und Rechtspopulisten aus den Parlamenten zu halten". Die Stadt stand vor einer doppelten Herausforderung: Das "rasante Wachstum Berlins" brachte die Infrastruktur an ihre Grenzen, während gleichzeitig der Aufstieg der AfD die liberale DNA der Stadt bedrohte. "Die europaweite Erfolgswelle von Rechtspopulisten und Rassisten macht deutlich, wie brüchig der demokratische Konsens einer offenen und pluralistischen Gesellschaft plötzlich sein kann", warnte die Partei.
In diesem Spannungsfeld sah sich die SPD Berlin gezwungen, eine doppelte Verteidigungslinie zu errichten. Unter dem programmatischen Titel "Hauptsache Berlin: Haltung und Verantwortung" kämpfte sie nicht nur den klassischen Kampf um materielle Sicherheit und soziale Gerechtigkeit, sondern gleichzeitig einen erbitterten Kampf um die Seele der Stadt. Die Partei versuchte, ihre abstrakte "Haltung" in ein dichtes Netz aus konkreten, oft technokratischen Regeln zu übersetzen, ein Unterfangen, das bemerkenswerte Widersprüche produzierte.
Die soziale Offensive. Das Versprechen der solidarischen Stadt und die Zerreißprobe des Haushalts
Die SPD Berlin formulierte 2016 ein umfassendes Versprechen: Berlin sollte eine "solidarische, weltoffene und tolerante Stadt" bleiben, in der "die wachsende Stadt menschlich gestaltet" wird. Dieses Versprechen übersetzte sich in eine beispiellose Welle sozialpolitischer Forderungen.
Im Bildungsbereich forderte die Partei, dass das "Schulsanierungsprogramm ohne finanzielle Abstriche zügig und zeitnah umgesetzt" werden müsse. Schulen sollten mit "110 % der Stellen" ausgestattet werden, um Unterrichtsausfall zu kompensieren. Die Klassengröße sollte auf "höchstens 25 Schülerinnen bzw. Schüler" begrenzt werden. Grundschullehrer*innen sollten "nicht länger weniger verdienen als ihre Kolleg:innen an den Oberschulen", eine tarifliche Gleichstellung wurde gefordert.
Im Arbeitsmarkt zielte die SPD auf die Beseitigung prekärer Beschäftigung. Wissenschaftler*innen, die "über Jahre hinweg in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen, mit Kurzzeitverträgen, mit extrem vielen unbezahlten Überstunden und mit geringem Lohn arbeiten", sollten Mindestvertragslaufzeiten von "mindestens einem Jahr" erhalten. Die Modernisierungsumlage für Mieter sollte auf "jährlich maximal fünf Prozent" begrenzt werden, mit einer Kappungsgrenze von "höchstens 3 Euro/qm innerhalb von acht Jahren".
Besonders aufschlussreich war die explizite Aussage zur Finanzpolitik: Die "schwarze Null" sei für die SPD "kein Selbstzweck". Dies war mehr als eine technische Anmerkung, es war eine politische Kampfansage an die Austeritätspolitik. Die Partei wollte "dauerhaft hohe Investitionen in den Ausbau der sozialen Infrastruktur – insbesondere in unsere Schulen und Kitas" und gleichzeitig keine Gesetze unterstützen, die "Wohnungsbau im gehobenen Segment mit Milliardensubventionen zulasten der Länderhaushalte fördern".
Der eingebaute Konflikt war offensichtlich: Ein maximalistisches Sozialprogramm traf auf die ungelöste Frage der Finanzierung. Die SPD wollte alles auf einmal – bessere Bezahlung, mehr Personal, massive Investitionen – ohne klar zu benennen, woher die Mittel kommen sollten.
Die ideologische Brandmauer. Kampfansage an Rechts und für die plurale Gesellschaft
Parallel zur sozialen Offensive errichtete die SPB Berlin 2016 eine unmissverständliche ideologische Brandmauer. "Die SPD schließt dabei für sich selbstverständlich jegliche Zusammenarbeit mit der AfD aus", hieß es kategorisch. Keine Koalition, keine Zählgemeinschaft, keine Kooperation in Bezirksämtern. Die Partei forderte einen "breiten demokratischen Konsens" aller demokratischen Parteien gegen die AfD.
Doch der Kampf gegen Rechts erschöpfte sich nicht in Abgrenzungsrhetorik. Die SPD kämpfte auf überraschenden Schlachtfeldern für ihre Vision einer pluralen Gesellschaft. Die Forderung nach der "konsequenten Umbenennung des U-Bahnhofes Mohrenstraße" war mehr als Symbolpolitik, sie war Teil eines umfassenden Programms gegen "Diskriminierung und Rassismus im Berliner Stadtbild". Die Partei forderte eine "kritische Überprüfung bestehender Namensgebungen auf nationalistischen, rassistischen, diskriminierenden und kolonialen Charakter".
Besonders brisant war die vehemente Ablehnung des Bundeswehreinsatzes im Innern. Das 2016 verabschiedete Weißbuch der Bundeswehr, das "Terroranschläge als besonders schwere Unglücksfälle zu definieren" erlaubte, wurde als "Aufweichen der verfassungsrechtlichen Grenzen" und "reine Angstpolitik" verurteilt. Die SPD zog hier eine klare verfassungsrechtliche rote Linie: "Keine Grundgesetzänderung zum Einsatz der Bundeswehr im Inneren".
Die Partei kämpfte auch gegen subtilere Formen der Diskriminierung: Sie forderte die Einrichtung einer "Werbewatchgroup in Berlin nach Wiener Vorbild" gegen sexistische Werbung und setzte sich für die "Öffnung der Ehe und das gleichberechtigte Volladoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare" ein. Das Motto "Gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus. Immer. Überall. #ausnahmslos" wurde zur Kampfansage gegen alle Formen der Diskriminierung.
Haltung wird zu Paragrafen. Der Versuch, Ideale in ein Korsett aus Regeln zu zwängen
Das vielleicht bemerkenswerteste Muster der SPD-Politik 2016 war der Versuch, große gesellschaftliche Visionen in ein extrem detailliertes Regelwerk zu übersetzen. Die Partei entwickelte eine Methode der Mikropolitik, die jeden Aspekt des gesellschaftlichen Lebens regulieren wollte.
Im Arbeitsmarkt wurden präzise Zeitvorgaben für die Regulierung von Leiharbeit formuliert: Nach "6 Monaten" sollte die Beweislast auf den Entleiher übergehen, ab "12 Monaten" musste nachgewiesen werden, dass die Stelle nicht regulär besetzt werden konnte, und nach "9 Monaten" sollten Leiharbeitnehmer*innen das gleiche Stundenentgelt erhalten.
Die Förderung bedürftiger Kinder sollte durch eine "mindestens Verdopplung des Beitrages" im Bildungspaket erfolgen. Für obdachlose Menschen sollten "jährlich nicht weniger als 80 Plätze" in Übergangsprojekten geschaffen werden. In Flüchtlingsunterkünften sollte "pro ca. 100 Bewohner*innen ein Sozialarbeiter" eingestellt werden.
Diese Detailarbeit zeigte sich überall: Die Einführung einer Schülerfrequenz von "20 Schülerinnen/Klasse" in der Schulanfangsphase, die Forderung nach "mindestens 50 Mbit/s" Breitbandinternet, die Festlegung des Rentenniveaus auf "mindestens 50 %", die Begrenzung der Mindestvertragslaufzeit für Wissenschaftler*innen auf "mindestens ein Jahr". Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Die kritische Frage drängt sich auf: War dieser technokratische Ansatz ein Zeichen für Gründlichkeit und Umsetzungswillen? Oder drohte die große Vision einer solidarischen Stadt in einem Dschungel aus Paragrafen und Verwaltungsvorschriften zu ersticken?
Ein Jahr der maximalen Ambition und die offenen Fragen
Das Jahr 2016 offenbarte eine SPD Berlin im Modus maximaler Ambition. Die Partei versuchte, gleichzeitig die materielle Sicherheit in einer wachsenden Stadt zu gewährleisten, die liberale Gesellschaft gegen den Rechtspopulismus zu verteidigen und ihre Werte in ein umfassendes Regelwerk zu gießen. "Sexuelle und gesundheitliche Selbstbestimmung sind Menschenrechte", proklamierte sie und forderte im gleichen Atemzug kostenlose Verhütungsmittel für alle.
Doch diese doppelte Verteidigungslinie – die materielle und die ideologische – erzeugte eine immense Spannung. War es realistisch, gleichzeitig massive Sozialinvestitionen zu fordern und die Schwarze Null für überholt zu erklären? Konnte man die komplexen Herausforderungen einer Metropole tatsächlich durch immer detailliertere Regelungen lösen?
Die SPD Berlin 2016 war eine Partei, die alles wollte und alles auf einmal. Sie kämpfte an allen Fronten, mit allen Mitteln, für eine Vision von Berlin als solidarischer und weltoffener Stadt. Ob dieser maximale Anspruch letztlich zu den gewünschten gesellschaftlichen Veränderungen führte oder neue Probleme schuf, bleibt die offene Frage dieses bemerkenswerten politischen Jahres. Die Spannung zwischen der allumfassenden sozialen Vision und den harten Grenzen der Machbarkeit prägte nicht nur 2016, sondern wirft auch heute noch Fragen auf: Wie viel Regelungsdichte verträgt eine liberale Gesellschaft? Und wie viel Ambition kann sich eine Stadt leisten, die gleichzeitig wächst und zusammenhalten will?
Mein Name ist Andreas Dahrendorf, 58, SPD‑Mitglied in Berlin-Kreuzberg‐61. Ich analysiere 4087 Parteitagsanträge der SPD‑Berlin (Jahrgänge 2014 – 2025) mit KI.
dahrendorfSignal, not noise