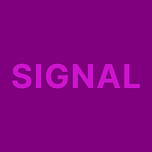Die fünf dominanten Politikfelder des Jahres 2014 waren: Jugend- und Bildungspolitik, Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik, Flüchtlings- und Integrationspolitik, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sowie Parteiorganisation und Demokratieförderung.
Die Anträge identifizieren bestehende Probleme in diesen Bereichen, stellen konkrete Lösungsvorschläge vor und benennen statistische Details sowie Zielkonflikte, die bei der Umsetzung entstehen könnten.
Ferner werden die wichtigsten Antragsteller – sowohl Kreisverbände als auch spezialisierte Arbeitsgemeinschaften – sowie einige thematisch einzigartige Anträge, wie die zur möglichen Olympia-Bewerbung und zur deutschen Kolonialgeschichte, hervorgehoben.
I. Die fünf dominantesten Politikfelder
Die Anträge konzentrieren sich primär auf die folgenden fünf Politikfelder:
1. Jugend- und Bildungspolitik
Probleme:
Veraltetes demografisches Konzept: Die bisherige Politik einer „alternden Stadt“ greift zu kurz, da „mehr junge Menschen und Familien nach Berlin ziehen und die Geburtenrate steigt“.
Mängel in der Schul- und Personalinfrastruktur: Es gibt einen „erheblichen Sanierungsstau an Schulen“, und der Lehrerberuf ist unattraktiv.
Mangelnde Medienkompetenz und digitale Ungleichheit: Diese Bereiche werden nicht ausreichend gefördert.
Unzureichende Jugendbeteiligung: Es fehlt eine institutionelle Verankerung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
Wichtigste Vorschläge:
Grundsätzliche Neuausrichtung und Stärkung der Jugendpolitik: Forderung nach Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz und der Berliner Verfassung sowie Einführung eines Jugendfördergesetzes.
Partizipation und Beteiligung von Jugendlichen: Erarbeitung eines Jugendbeteiligungskonzepts, Einrichtung von Kinder- und Jugendparlamenten in allen Bezirken und Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre.
Bildungsqualität und -infrastruktur: Beschleunigte Sanierung von Schulen (auch in Kooperation mit Wohnungsbaugesellschaften) und Ablehnung von Schulschließungen zur Haushaltskonsolidierung.
Personalentwicklung: Reduzierung des Quereinsteiger-Programms und Verbesserung der Vergütung von Erzieher*innen.
Zentrale Kennzahlen/Fakten:
Schülerzahlen in Marzahn-Hellersdorf verdoppelten sich in den letzten fünf Jahren.
Berlinweiter Zuwachs der Schülerzahl um 15% bis 2022/2023 erwartet.
Schulneubau dauert in der Regel mindestens 7 Jahre.
Ausbildungsquote in der Verwaltung soll auf mindestens 10% erhöht werden.
Zielkonflikte:
Demografisches Wachstum vs. Bau- und Infrastrukturkapazitäten: Der schnelle Anstieg der Schülerzahlen steht im Konflikt mit der langen Dauer von Schulneubauten.
Qualität des Lehrpersonals vs. akuter Personalmangel: Die Forderung, das Quereinsteiger-Programm „massiv zurückzufahren“, kollidiert mit dem „erheblichen Personalmangel“.
Hauptantragsteller: Jusos Berlin, Fachausschuss IV - Kinder, Jugend, Familie, AG Selbst Aktiv, AG Migration und Vielfalt, Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB), sowie Kreisdelegiertenversammlungen (KDVn) aus Marzahn-Hellersdorf, Tempelhof-Schöneberg, Spandau, Neukölln und Lichtenberg.
2. Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik
Probleme:
Knappheit und Unbezahlbarkeit von Wohnraum: Der Wohnungsmarkt ist „seit Jahren angespannt“, „Preiswerte für untere und mittlere Einkommensgruppen, bezahlbare Wohnungen [sind] knapp“. Dies führt zur „Angst vor Verdrängung“.
Fehlende soziale Durchmischung und Gentrifizierung: Die „einst typische sozialstrukturelle Mischung in Berlin“ ist „gefährdet“.
Mangelnde Barrierefreiheit: Es besteht ein „Missverhältnis zwischen dem aktuellen Bedarf und dem vorhandenen bezahlbaren barrierefreien bzw. barrierearmen Wohnraum“.
Wichtigste Vorschläge:
Wohnungsneubau und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum: Steigerung des jährlichen Neubaus auf mindestens 15.000 Wohnungen.
Stärkung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften durch Reduzierung der Rendite-Vorgaben auf 3%.
Mieterschutz: Anwendung der Mietpreisbremse auf das gesamte Berliner Stadtgebiet für die Dauer von fünf Jahren.
Barrierefreiheit: Gesetzliche Verankerung eines barrierefreien Wohnumfeldes bei Neubauten, Einführung einer Quote von 5% Rollstuhlfahrer-Wohnungen und 5% barrierefreien Wohnungen im geförderten Neubau.
Zentrale Kennzahlen/Fakten:
Jährlicher Neubaubedarf von mindestens 15.000 Wohnungen.
Seit 2010 Zunahme der Einwohnerzahl um fast 200.000.
Wohnungsbauförderung soll auf 5.000 Wohnungen/Jahr ausgeweitet werden.
Mittelfristiges Ziel: ein kommunaler Wohnungsbestand von 400.000 Einheiten (20% des Gesamtbestands).
Forderung nach 100 zusätzlichen Stellen für Bau- und Wohnungsämter.
Zielkonflikte:
Wachstum vs. Bezahlbarkeit: Der hohe Bedarf an Neubau führt in der Realität vor allem zum Bau teurer Wohnungen, was dem Ziel des bezahlbaren Wohnraums widerspricht.
Sparvorgaben vs. Personalbedarf: Die politisch gesetzte Obergrenze von 100.000 Verwaltungsmitarbeitern steht im Widerspruch zum realen Personalbedarf.
Flächennutzung: Die Notwendigkeit des Wohnungsneubaus konkurriert direkt mit der Forderung, innerstädtische Grünflächen zu schützen.
Hauptantragsteller: Zahlreiche KDVn (Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Lichtenberg, Reinickendorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Marzahn-Hellersdorf), Jusos Berlin, AG Selbst Aktiv, FA VIII „Soziale Stadt“, ASJ Berlin, AG Migration und Vielfalt.
3. Flüchtlings- und Integrationspolitik
Probleme:
Mangel an dezentralem Wohnraum: Der „Aufenthalt in einem Heim [ist] in jedem Fall zeitlich zu begrenzen“, und Asylbewerber*innen dürfen nicht in Obdachlosigkeit entlassen werden.
Unzureichende soziale und medizinische Leistungen: Es fehlen „kostenfreie Integrations- und Sprachkurse ab dem Zeitpunkt der Antragsstellung“ und der Zugang zu „kostenfreier psychologischer Hilfe“.
Rechtliche und bürokratische Hürden: Problematisch sind „Abschiebung von Frauen und Mädchen, die in Deutschland aufgewachsen sind, in Länder mit patriarchalischen Strukturen“ und die „Residenzpflicht“.
Wichtigste Vorschläge:
Wohnsituation und Unterbringung: Entwicklung eines „Masterplans zur dezentralen Unterbringung“ und Unterbringung nur in Wohnbauten.
Soziale Leistungen und Unterstützung: Recht auf kostenfreie Integrations- und Sprachkurse ab Antragsstellung, Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und stattdessen Leistungen nach SGB II/XII.
Medizinische Versorgung: Angleichung der medizinischen Versorgung an den Standard gesetzlich Versicherter.
Abbau rechtlicher Hürden: Verhinderung von Abschiebungen von in Deutschland aufgewachsenen Frauen und Mädchen in patriarchalische Länder, Abschaffung der Sprachprüfung vor Einreise für Ehepartner und Abschaffung der Residenzpflicht.
Zentrale Kennzahlen/Fakten:
Gemeinschaftsunterkünfte sollen mindestens 10 Quadratmeter pro Person bieten, mit nicht mehr als zwei Personen pro Zimmer.
Asylanträge sollen innerhalb von drei Monaten abschließend bearbeitet werden.
Flüchtlingskinder und schulpflichtige Jugendliche bis 21 Jahre sollen unverzüglich einen Kita- oder Schulplatz erhalten.
Es soll eine vom Land finanzierte Vollzeitstelle pro Bezirk zur Ehrenamtskoordination eingerichtet werden.
Zielkonflikte:
Umfang der Rechte vs. „keine gesonderten Rechte“: Eine Forderung, Flüchtlingen keine gesonderten Rechte einzuräumen, die anderen Ausländern verwehrt bleiben, steht im Gegensatz zu zahlreichen Forderungen nach sofortigen und umfassenden spezifischen Leistungen.
Effizienz vs. Gründlichkeit im Asylverfahren: Die Forderung nach einer schnellen Bearbeitung innerhalb von „drei Monaten“ steht im Konflikt mit der Notwendigkeit einer „angemessenen Prüfung aller Umstände“ und traumasensibler Prozesse.
Hauptantragsteller: AG Migration und Vielfalt, Jusos Berlin, sowie KDVn Spandau, Mitte und Neukölln.
4. Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
Probleme:
Prekäre Arbeitsbedingungen: Besonders in der Kreativwirtschaft und Pflege („schlechte Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen“).
Personalmangel in der Verwaltung: „Personalabbau im Berliner öffentlichen Dienst“ führt zu fehlenden Steuereinnahmen.
Unzureichende soziale Leistungen: Das Asylbewerberleistungsgesetz und das „Sanktionssystem“ im Hartz-IV-System werden kritisiert („treibt Menschen nicht nur in die Wohnungslosigkeit, sondern auch in die Kriminalität“).
Mangelnde Inklusion und Barrierefreiheit: Ungenügende Umsetzung der Inklusion in der Bildungslandschaft und Mangel an barrierefreiem Wohnraum und Verkehrsmitteln.
Wichtigste Vorschläge:
Arbeitsbedingungen und Soziale Absicherung: Aktionsprogramm gegen prekäre Beschäftigung, Lohndumping und Tarifflucht; Abschaffung des Schulgeldes in der Altenpflegeausbildung.
Soziale Leistungen und Integration: Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes, Einschränkung der Hartz-IV-Sanktionen (Höchstsanktion 30%, keine Kürzung der Mietkosten).
Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik: Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, wirksame Umsetzung des Zweckentfremdungsverbots und gesetzliche Verankerung von Barrierefreiheit.
Bildung und Verwaltung: Beendigung des „willkürlich festgelegte[n] Ziels von 100.000 Beschäftigten“ in der Verwaltung und Erhöhung der Ausbildungsquote auf mindestens 10%.
Zentrale Kennzahlen/Fakten:
Über 100.000 gekürzte Stellen in der Pflege nach Abschaffung der Pflege-Personal-Regelung.
Forderung nach 300 zusätzlichen Pflegekräften an der Charité.
Dem Staat entgehen jährlich Steuern in zweistelliger Milliardenhöhe.
Einnahmen aus der City-Tax von 25 Mio. Euro sollen für Kultur verwendet werden.
Zielkonflikte:
Finanzielle Sparziele vs. Investitions- und Personalbedarf: Die Kritik am Ziel von 100.000 Beschäftigten und die Forderung nach einer „sofortigen öffentlichen Investitionsoffensive“ stehen im Konflikt mit Sparzielen.
Soziale Integration vs. Sanktionierung: Die Priorität der sozialen Integration kollidiert mit dem kritisierten „Sanktionssystem“ bei Hartz IV.
Marktlogik vs. Soziale Verantwortung im Wohnungsbau: Das Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu sichern, steht im fundamentalen Konflikt mit der Realität des freien Immobilienmarktes.
Hauptantragsteller: Zahlreiche KDVn (Spandau, Lichtenberg, Mitte, Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf, Marzahn-Hellersdorf), Jusos Berlin, AG Selbst Aktiv, AG Migration und Vielfalt, ASJ Berlin, AfA.
5. Parteiorganisation und Demokratieförderung
Probleme:
Fehlende Transparenz und Zugänglichkeit bei Anträgen: Mitglieder können den Status ihrer Anträge nicht selbstständig verfolgen.
Unzureichende Einbindung von Fachexpertise und mangelnde Repräsentation bestimmter Arbeitsgemeinschaften.
Fehlende Geschlechterparität und eingeschränkte Beteiligung der Basis.
Mangelnde Barrierefreiheit in Parteieinrichtungen und finanzielle Hürden bei Parteischulangeboten.
Wichtigste Vorschläge:
Stärkung der Antragskommission und Transparenz: Einrichtung eines online zugänglichen Systems zur Antragsverfolgung „innerhalb eines Jahres“.
Stärkung der Jugendbeteiligung: Verankerung der UN-Kinderrechtskonvention in der Berliner Verfassung und Einrichtung von Kinder- und Jugendparlamenten.
Förderung von Geschlechterparität und Vielfalt: Entwicklung einer Regelung zur geschlechterparitätischen Quotierung des Landesvorstands.
Transparenz und Beteiligung bei der Wahlprogrammarbeit: Durchführung eines beteiligungsorientierten Prozesses unter Einbezug der Parteibasis.
Direkte Demokratie auf Landesebene: Gewährung des Teilnahmerechts an Volksbegehren unabhängig von der Staatsbürgerschaft und Erarbeitung eines Landesdemokratiegesetzes.
Zugänglichkeit und Barrierefreiheit: Barrierefreier Umbau aller zugänglichen Einrichtungen der SPD.
Zentrale Kennzahlen/Fakten:
Alle Angebote der Parteischule sollen für Mitglieder „finanzierbar sein“ oder „kostenlos zur Verfügung stehen“.
Bei baulichen Großvorhaben ab zwei Hektar soll eine verpflichtende Bürgerbeteiligung stattfinden.
Die Zielzahl von 100.000 Beschäftigten in der Verwaltung wird kritisiert.
Zielkonflikte:
Finanzierung der Parteischule: Die Forderung nach einer vollständig „kostenlosen“ Parteischule steht im Widerspruch zum Vorschlag einer „finanzierbaren“ Teilnahme.
Personalpolitik in der öffentlichen Verwaltung: Das politisch gesetzte Ziel, die Beschäftigtenzahl auf 100.000 zu begrenzen, steht im klaren Widerspruch zur Forderung nach einer bedarfsgerechten Personalentwicklung.
Hauptantragsteller: KDVn Lichtenberg, Abt. 02 | Pankow, KDV Mitte, KDV Treptow-Köpenick, Jusos Berlin, AG Selbst Aktiv, AG Migration und Vielfalt, ASF Landesvorstand.
II. Einzigartige und herausragende Anträge
Zwei Anträge heben sich in Ton, Thema und Dringlichkeit besonders stark ab:
Antrag 143/II/2014 ("Olympia? Nur unter unseren Bedingungen."):
Konditionaler und fordernder Ton: Eine Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Berlin darf „Nur unter unseren Bedingungen“ und mit nicht verhandelbaren Kriterien erfolgen.
Umfassendes Stadtentwicklungsprogramm: Verknüpfung mit nachhaltigem Infrastrukturkonzept, Modernisierung des ÖPNV, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum (z.B. Umnutzung eines Olympischen Dorfes in Studentenwohnungen) und absoluter Barrierefreiheit.
Bürgerbeteiligung: Forderung nach einer verbindlichen Volksabstimmung der Berlinerinnen und Berliner vor einer Bewerbung.
Historische Verantwortung: Die Spiele von 1936 und der Umgang mit Deutschlands NS-Vergangenheit müssen thematisiert werden, sowie die Stärkung der Menschenrechte und Sicherstellung des Meinungs- und Demonstrationsrechts für alle Delegierten.
Zielkonflikt: Das Potenzial für sozialen Wohnungsbau durch ein Olympisches Dorf steht im Konflikt mit der strikten Bedingung einer transparenten Kostenermittlung und einer Bürgerabstimmung, was auf eine erhebliche Skepsis gegenüber den finanziellen Risiken hindeutet.
Antrag 157/I/2014 ("Völkermord verjährt nicht! Für einen verantwortlichen Umgang mit der deutschen Kolonialgeschichte in Namibia"):
International und historisch weitreichend: Fordert die offizielle rückwirkende Anerkennung des Völkermords in Namibia, eine Entschuldigung des Bundestages und der Bundesregierung sowie Reparationszahlungen.
Präzedenzfall: Zielt darauf ab, einen Präzedenzfall für den Umgang mit Deutschlands Kolonialgeschichte zu schaffen. Dies ist für einen Landesparteitag ein außergewöhnliches Anliegen.
III. Allgemeine Stoßrichtung der Anträge
Die Anträge der SPD Berlin betonen durchgängig die öffentliche Verantwortung für Daseinsvorsorge und streben eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe an. Dies zeigt sich in wiederkehrenden Forderungen nach:
Stärkung kommunaler und staatlicher Dienstleistungen (Wohnungsbaugesellschaften, öffentlicher Dienst).
Abbau von Hürden für marginalisierte Gruppen (Flüchtlinge, Menschen mit Behinderungen, Geringverdiener).
Umfassende Bürgerbeteiligung und Transparenz, sowohl innerhalb der Partei als auch auf Landesebene.
Die Anträge richten sich dabei oft nicht nur an die Berliner Landespolitik, sondern auch an die Bundes- und Europapolitik, insbesondere bei Themen wie Freihandelsabkommen (TTIP/CETA), sozialer Liegenschaftspolitik des Bundes und der Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes.